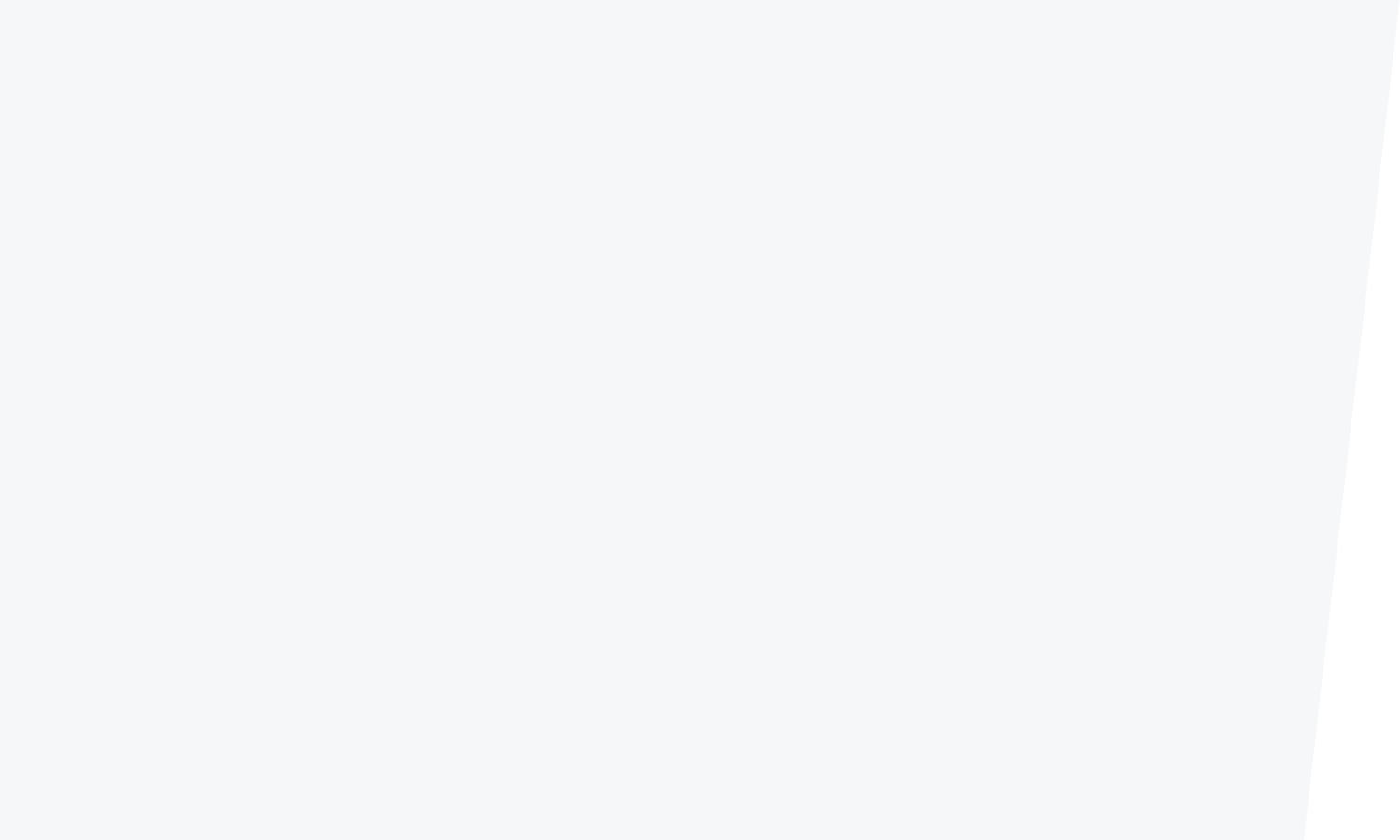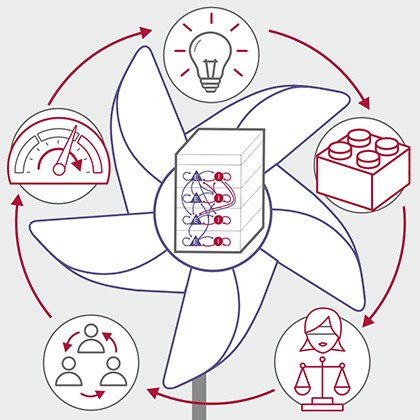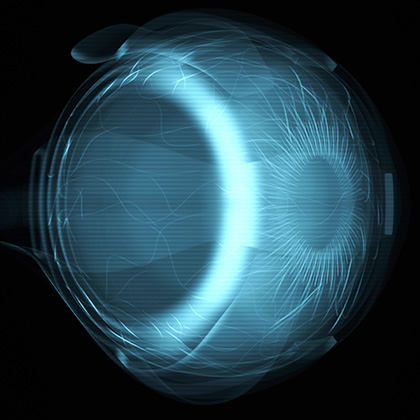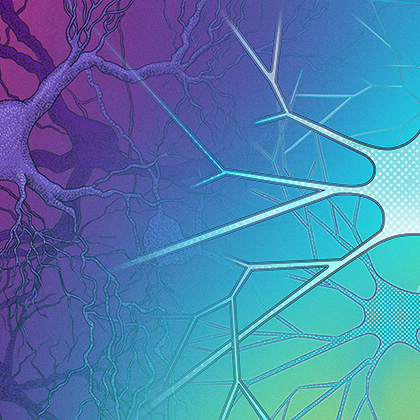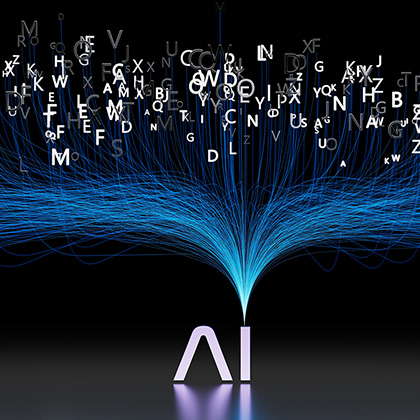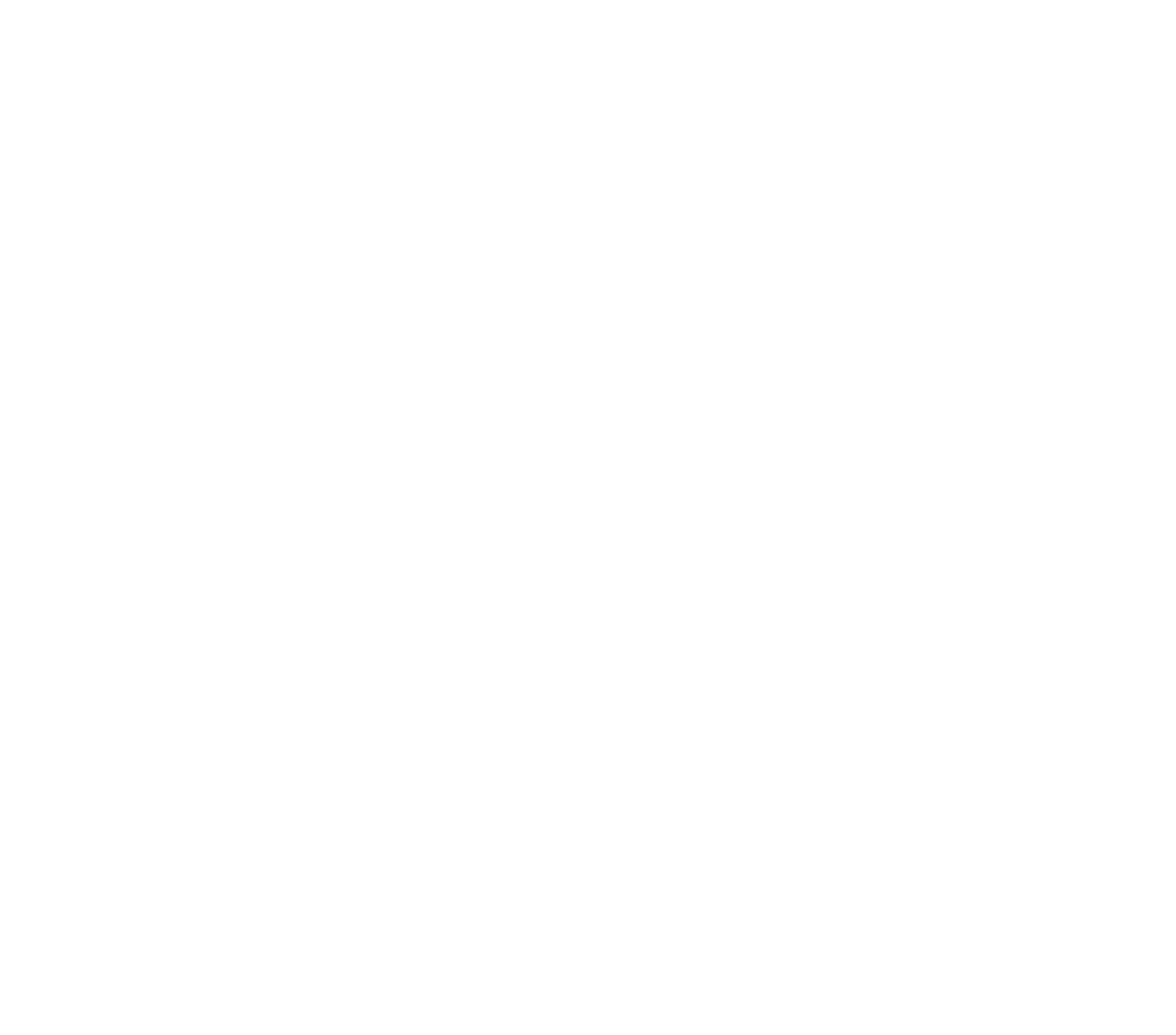Aktuelles aus dem Bernstein Netzwerk. Hier finden Sie die neuesten Nachrichten unserer Forscher:innen im Hinblick auf aktuelle Forschungsergebnisse, neue Forschungsprojekte und -initiativen sowie Auszeichnungen und Preise.
Was Mitochondrien über das Gehirn verraten
Internationale Forschende haben die Verteilung der Mitochondrien, der Energieproduzenten der Zellen, im Gehirn untersucht. Die Ergebnisse bieten neue Perspektiven auf die Organisation neuronaler Netzwerke und deren Leistungsfähigkeit.
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis geht an Klaus-Robert Müller
Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat heute die Preisträger:innen des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises bekanntgegeben, der als die höchste Auszeichnung für Forschende in Deutschland gilt. Unter den 10 Preisträger:innen ist Prof. Dr. Klaus-Robert Müller, Leiter der „Machine Learning Group“ und Co-Direktor des „Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data“ (BIFOLD) an der TU Berlin. Er gilt als Pionier des „Maschinellen Lernens“ und treibt diese wichtige Richtung der Künstlichen Intelligenz (KI) seit 1989 voran. Dabei verbindet er Exzellenz im formalen mathematischen Denken mit einer stark anwendungsorientieren Herangehensweise. In seinem interdisziplinären Ansatz vereint er Bereiche wie Biologie, Medizin, Chemie, Mathematik und Informatik miteinander.
Anerkennung für Spitzenforschung
Die Neurowissenschaftlerin Professorin Dr. Kristine Krug von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist erneut als Visiting Professor of Neuroscience an die renommierte britische University of Oxford berufen worden. Der Medical Sciences Board der Universität Oxford bestätigte den nicht vergüteten Titel für weitere fünf Jahre.
Quantensensoren: Hochpräzise Messungen im bewegten Gehirn
Was passiert bei einem epileptischen Anfall im Gehirn? Wie arbeiten die Nervenzellen nach einer Lähmung durch Schlaganfall? Was geschieht im Kopf von Parkinson-Erkrankten? Bislang war die Untersuchung solcher Fragen schwierig, weil die Patientinnen und Patienten hierfür still halten mussten. Mit der Optisch gepumpten Magnetoenzephalographie (OPMEG) sind nun auch Aufnahmen in Bewegung möglich. Prof. Dr. Dominik Bach, Hertz-Professor für Künstliche Intelligenz und Neurowissenschaften an der Universität Bonn, errichtet nun auf dem Campus des Universitätsklinikums Bonn (UKB) eine solche Forschungsinfrastruktur. Diese wird aus dem EFRE/JTF-Programm der Europäischen Union und der Landesregierung NRW in den nächsten drei Jahren mit fast vier Millionen Euro gefördert.
Zehn Jahre PD14: Meilenstein-Modell prägt digitale Neurowissenschaften und KI-Forschung
Neuronale Schaltkreismodelle helfen besser zu verstehen, wie Nervenzellen im Gehirn zusammenarbeiten, und lassen sich rechnergestützt weiter für die Hirnforschung nutzen. Ein wichtiger Schritt hin zu computergestützten Neurowissenschaften war das Modell des frühen sensorischen Kortex von Dr. Tobias Potjans und Prof. Markus Diesmann, kurz PD14 genannt. Veröffentlicht im Jahr 2014, wurde es zu einem Standard in der Forschung – als Grundlage für komplexere Gehirnmodelle, als Testwerkzeug für Rechenmethoden und als Maßstab für die Leistungsfähigkeit neuer Computersysteme.
Im April 2024 kamen Forschende aus aller Welt am Käte Hamburger Kolleg Cultures of Research der RWTH Aachen zusammen, um anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Modells seine Bedeutung für die Forschung in den Computer- und theoretischen Neurowissenschaften zu beleuchten. Die Ergebnisse des Symposiums wurden jetzt im Fachmagazin Cerebral Cortex veröffentlicht. Im Interview gehen Prof. Markus Diesmann und Prof. Hans Ekkehard Plesser, Erstautor des Reports, auf die Bedeutung von PD14 sowie Chancen und Herausforderungen der digitalen Neurowissenschaften ein, wie sie sich z. B. in der europäischen Forschungsplattform EBRAINS zeigen.
Biologische Intelligenz als Grundlage für neue KI-Systeme
In einem neuen Projekt unter Leitung des ZI wird erforscht, wie Erkenntnisse über Lernprozesse in Tiergehirnen genutzt werden können, um Künstliche Intelligenz flexibler und effizienter zu machen.
Wenn die KI so „denkt“ wie wir
Auch wenn die so genannten Vision Foundation Modelle, Computermodelle für die automatisierte Bilderkennung, in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht haben – sie unterscheiden sich immer noch deutlich vom menschlichen visuellen Verständnis. Zum Beispiel erfassen sie in der Regel keine mehrstufigen semantischen Hierarchien und haben Schwierigkeiten, mit Beziehungen zwischen semantisch verwandten, aber visuell unähnlichen Objekten. In einem gemeinsamen Projekt mit Google DeepMind haben Wissenschaftler:innen der TU Berlin, des MPI CBS und des MPI für Bildungsforschung einen neuen Ansatz „AligNet“ entwickelt, der erstmals menschliche semantische Strukturen in neuronale Bildverarbeitungsmodelle integriert und damit das visuelle Verständnis der Computermodelle dem des Menschen annähert. Die Ergebnisse wurden jetzt unter dem Titel „Aligning Machine and Human Visual Representations across Abstraction Levels“ in dem renommierten Fachmagazin Nature veröffentlicht.
Software optimiert Simulationen des Gehirns
Eine neue Software ermöglicht Gehirnsimulationen, die sowohl detailliert die Prozesse im Gehirn imitieren als auch anspruchsvolle kognitive Aufgaben lösen können. Entwickelt wurde das Programm von einem Forschungsteam am Exzellenzcluster „Maschinelles Lernen: Neue Perspektiven für die Wissenschaft“ der Universität Tübingen. Die Software bildet damit die Grundlage für eine neue Generation von Gehirnsimulationen, die tiefere Einblicke in die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit des Gehirns ermöglichen. Die Arbeit der Tübinger Forschenden wurde in der Fachzeitschrift Nature Methods veröffentlicht.
FAU-Forscher stützen Theorie der kognitiven Linguistik
KI-Modelle sind in der Lage, Regeln der menschlichen Sprache herzuleiten, ohne dass sie mit expliziten Informationen über Grammatik und Wortklassen versorgt werden. Das haben Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in einem Experiment nachgewiesen. Damit stützen sie die Theorie der kognitiven Linguistik, nach der – im Gegensatz zur Theorie der Universalgrammatik – das Verständnis für syntaktische Konstruktionen nicht angeboren ist, sondern beim Sprachgebrauch erlernt wird. Die Ergebnisse der Studie sind im renommierten Sammelband Recent Advances in Deep Learning Applications: New Techniques and Practical Examples veröffentlicht worden.
Teamwork im Innenohr – unser Hören baut auf organisierte Gruppierung von Proteinen
Forschenden am Göttingen Campus ist es erstmals gelungen, die winzigen Synapsen im Innenohr – die Kontaktstellen zwischen den Haarsinneszellen und den Hörnervenzellen – auf molekularer Ebene zu untersuchen. Sie konnten zeigen, dass sich Ionenkanäle und weitere synaptische Proteine, die für das Hören essentiell sind, in spezifischen Mustern organisieren. Diese Anordnung sorgt für eine optimierte Weiterleitung der Hörinformationen an das Gehirn. Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, Therapien für Hörstörungen mit synaptischer Ursache zu entwickeln. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Science Advances erschienen.