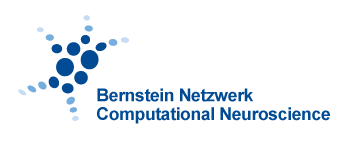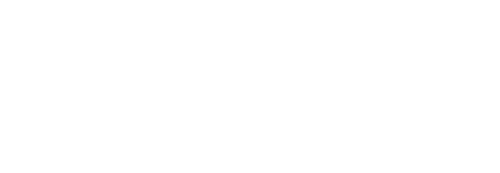Human Brain Project: Warum die Hirnforschung Simulationsmethoden braucht
HBP-WissenschaftlerInnen sehen in Hirnsimulatoren "mathematische Observatorien" für die Neurowissenschaften

© Pixabay
Die Simulation großskaliger neuronaler Netze ist ein Kernthema des europäischen Human Brain Project (HBP). In einem neuen Artikel begründen WissenschaftlerInnen des HBP, warum Simulationen in den Neurowissenschaften notwendig sind, um eine Brücke zwischen der neuronalen und der Systemebene des Gehirns zu schlagen. Die AutorInnen betonen die Notwendigkeit frei zugänglicher Simulationsplattformen, mit denen eine Vielzahl potentieller Modelle des Gehirns auf verschiedenen biologischen Detailebenen simuliert und konkrete Vorhersagen über diese Modelle gewonnen werden können. Der Vergleich mit experimentellen Daten ermöglicht dann das systematische Testen und Verfeinern der Modelle im engen Zusammenspiel zwischen computergestützten und experimentellen Neurowissenschaften.
Heutzutage kommt in den Neurowissenschaften eine Vielzahl von experimentellen Techniken zum Einsatz, um mit Hilfe gemessener Hirnsignale Einblicke in die neuronale Funktionsweise des Gehirns zu gewinnen. Um jedoch die komplexe, nichtlineare Dynamik des Gehirns zu verstehen und zu erklären, wie Gehirnaktivität und Signale zusammenhängen, sind rechnergestützte Modelle erforderlich. Laut den AutorInnen des neuen Artikels “The scientific case for brain simulation“, alle mit dem Europäischen Flaggschiff Human Brain Project affiliiert, stellen Simulationen die entscheidende Verbindung zwischen diesen Modellen und experimentellen Daten her.
Grundlage für derartige Gehirnsimulationen bildet die Simulationsplattform des Human Brain Projects (HBP). Sie ist Teil der HBP Forschungsinfrastruktur für Hirnforschung und der neurowissenschaftlichen Community offen zugänglich. Die Hirnnetzwerksimulatoren der Plattform werden kontinuierlich verbessert und haben die Entwicklung von rechnergestützten Modellen und Simulationen auf verschiedenen Ebenen vorangetrieben – von einzelnen Neuronen bis hin zu großen, hirnweiten Netzwerken.
Da die Begriffe oft nicht klar getrennt werden, betonen die ForscherInnen den Unterschied zwischen allgemeinen Simulatoren und konkreten mathematischen Modellen. Während mathematische Modelle viele verschiedene Hypothesen über die Funktion des Gehirns in Form von Gleichungen und experimentellen Parametern abbilden können, können “Hirnsimulatoren als ‚mathematische Observatorien’ zum Test von verschiedenen potentiellen Hypothesen betrachtet werden. Ein Hirnsimulator ist also ein Werkzeug, keine Hypothese, und kann als solches mit Werkzeugen verglichen werden, die zur Darstellung der Gehirnstruktur oder -aktivität verwendet werden”, schreiben die WissenschaftlerInnen. In diesem Kontext bedeute Simulation die Anwendung von hochentwickelter Software, um komplexe mathematische Modelle des Gehirns in Bewegung zu setzen, die eine große Anzahl von miteinander verbundenen Neuronen repräsentieren – und zu beobachten, welche Vorhersagen sich daraus ergeben.
“Die Simulation stellt nicht das Ziel selbst dar, sondern dient als ein wirksamer neuer Weg, um konkurrierende Hypothesen über das Gehirn zu testen”, erklärt Gaute Einevoll, Professor an der Norwegian University of Life Sciences (NMBU) und Erstautor des Artikels. Dies ermögliche ein systematisches “biologisches Nachahmungsspiel”, bei dem Modelle, die die besten Vorhersagen über experimentelle Daten liefern, “gewinnen”.
Um das zu veranschaulichen, zieht Einevoll eine Analogie aus der Geschichte der Physik heran: “Unser Projekt ist vergleichbar mit Isaac Newtons Entwicklung eines neuen mathematischen Zweiges. Newton musste die Infinitesimalrechnung, engl. Calculus, entwickeln, um zu überprüfen, ob sein vorgeschlagenes Gravitationsgesetz über die Anziehung von Massen wie Planeten korrekt war oder nicht. Erst damit konnte er die Planetenbahnen in seinem Modell berechnen und überprüfen, ob seine Theorie mit den Beobachtungen übereinstimmte. Mit der von uns entwickelten Simulationsinfrastruktur können wir ebenfalls testen, ob konkurrierende Netzwerkmodelle Vorhersagen liefern, die mit experimentellen Messungen übereinstimmen. Diese Herangehensweise wird für den weiteren wissenschaftlichen Fortschritt von großer Bedeutung sein“, sagt Einevoll.
Während für die Erstellung eines detaillierten mathematischen Modells eine Vielzahl von Daten aus Experimenten integriert und verallgemeinert werden muss, sind die Grundlagen der Netzwerksimulatoren einfacher und gut etabliert, erklärt der Artikel – sie stützen sich auf “biophysikalische Prinzipien der elektrischen Aktivität in Neuronen und wie Neuronen synaptische Inputs aus anderen Neuronen integrieren und Aktionspotenziale generiert werden. Diese fundamentalen Prinzipien […] sind die einzigen Hypothesen, die der Entwicklung von Hirnnetzwerksimulatoren zugrunde liegen. Das ist der Grund, warum viele Modelle mit demselben Simulator dargestellt werden können und warum es möglich ist, allgemein anwendbare Simulatoren für die Neurowissenschaft zu entwickeln.” Ein Simulator kann viele verschiedene konkrete Modelle simulieren und während einige Modelle nach kurzer Zeit ihre Relevanz verlieren mögen, wird Simulationssoftware über Jahrzehnte genutzt, gepflegt und verbessert.
“In den letzten Jahren haben sich Hirnnetzwerksimulatoren enorm weiterentwickelt. Stark gewachsen sind auch der erreichbare Umfang und die Anwendungsgebiete der Simulationen”, sagt Co-Autor Markus Diesmann, theoretischer Neurowissenschaftler am Forschungszentrum Jülich und einer der Entwickler der Simulationssoftware NEST (Neural Simulation Tool). Simulatoren wie NEURON, Arbor, NEST oder TVB (The Virtual Brain) bilden das Rückgrat des HBP und ermöglichen Netzwerksimulationen mit unterschiedlichen Auflösungsstufen und biologischen Details. Je nach Fragestellung bietet jeder Simulator spezifische Vorteile.
“Diese ausführlich getesteten Simulatoren spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Forschung durch digitalisierte Arbeitsabläufe. Hier Fortschritte zu erzielen ist entscheidend, um auf der Arbeit anderer aufbauen zu können”, sagt Sonja Grün, Datenanalyse-Expertin in Jülich und Mitverfasserin der Studie. “Außerdem schafft die digitale Infrastruktur eine neue Kultur der groß angelegten Zusammenarbeit zwischen experimenteller und theoretischer Neurowissenschaft, die wir so bisher noch nicht hatten”, fügt Diesmann hinzu.
Dieser kollaborative Ansatz, der in Disziplinen wie der Physik oder der Astronomie bereits Routine ist, wäre auch für die Neurowissenschaften ein entscheidender Schritt, um sich der überwältigenden Komplexität des Gehirns zu nähern, betonen die WissenschaftlerInnen in ihrem Artikel: “Newton sagte, dass er weiter gesehen habe als andere, weil er auf den Schultern von Riesen stand. Ebenso argumentieren wir, dass wir einen Weg finden müssen, um auf den Schultern der mathematischen Modelle des anderen zu stehen, um ein detailliertes Verständnis der Funktionsweise der Netzwerke des Gehirns erlangen zu können.”
Übersetzung eines teilweise vom HBP Partner NMBU adaptierten englischen Originaltextes
>> zur originalen Pressemitteilung (englischer Text)